Arbeitswelt: Günter Wallraff buk als Niedriglöhner Brötchen | ZEIT online
Unser täglich Brötchen
Von Günter Wallraff | © DIE ZEIT, 01.05.2008 Nr. 19
Schlagworte: Günter Wallraff Arbeitsbedingungen Arbeit Wirtschaft
Schöne neue Arbeitswelt: Brandblasen an Armen und Händen, der ständige Kampf gegen den Schimmel und ein Chef, der seine Arbeiter wie Sklaven behandelt. ZEITmagazin-Reporter Günter Wallraff war wieder undercover unterwegs. Diesmal als Niedriglöhner in einer Fabrik, die Brötchen für Lidl backt.
Ich hätte diesem Brief, der keinen Absender und keinen Namen trug, kaum Beachtung geschenkt, wenn ich nicht schon wenige Tage nach seinem Eintreffen einen Anruf erhalten hätte, der mir von dem gleichen Umstand berichtete: dass die Arbeiter einer Backfabrik im Hunsrück unter unwürdigen Bedingungen schufteten und dass dringend Hilfe geboten sei, dies aufzudecken. Ich bat den Anrufer, mir Details und seinen Namen zu nennen, aber er sagte nur: »Wenn herauskommt, dass ich mit Ihnen gesprochen habe, werde ich fristlos entlassen. Ich wäre nicht der Erste, dem das passiert. Hier geht die Angst um.« Dann legte der Anrufer auf.
Die Backfabrik Weinzheimer liegt in Rheinland-Pfalz, in dem 3200-Einwohner-Städtchen Stromberg. Auf der Homepage wirbt die Fabrik mit ihrer 600 Jahre alten Backtradition. Das Logo der Firma ist ein stilisierter Laib Brot. Laut Eigenwerbung vertreibt das Unternehmen seit dem Jahr 1900 »Original Hunsrücker Brot«. In Wahrheit werden hier keine Brote mehr gebacken, das ergeben meine ersten Recherchen, sondern ausschließlich Brötchen, genauer: Aufbackbrötchen. Und diese wiederum ausschließlich für Lidl, europaweit.
Ich will wissen, wie es in einer Firma zugeht, die sich einem einzigen Großabnehmer ausgeliefert hat, noch dazu dem Discounter Lidl, der dafür bekannt ist, aus seinen Mitarbeitern und Zulieferern das für ihn Optimale herauszupressen und dessen Konzernherr Dieter Schwarz auf diese Weise mit seinen mehr als 10 Milliarden Euro Ersparnissen zum viertreichsten Deutschen emporstieg.
Viele Produkte, die wir kaufen, werden nicht mehr in Deutschland hergestellt, sondern in China, Indien oder Rumänien, wo man den Arbeitern weniger zahlt, wo sie weniger gut oder gar nicht versichert sind und weniger gut oder gar nicht gegen Gefahren geschützt. Wie reagiert ein Betrieb, der in Deutschland produziert, auf den Kostendruck? Kann es sein, dass die Arbeitsbedingungen der sogenannten Dritten Welt bereits Einzug gehalten haben in unsere »schöne neue Arbeitswelt«?
Ich will es wissen. Auf der Homepage steht, dass in der Firma »qualifizierte Mitarbeiter im Einklang mit der Backkunst backen«. Ich bin zwar weder qualifiziert, noch verstehe ich etwas von Backkunst, dennoch rufe ich an, um mich als Arbeiter anzubieten. Von einem Angestellten erfahre ich, sie suchten »20 bis 30 Jahre alte Männer, die robust sind und belastbar« – also nicht mich. Ich gebe vor, 51 Jahre alt zu sein statt 65, und habe mir die Identität eines Freundes geliehen. Frank K. heiße ich jetzt. Ich muss es mit Chuzpe versuchen.
Falsche Haare und ein dünner Oberlippenbart verjüngen mich. So schwinge ich mich im Sportdress auf mein Rennrad, um direkt vor dem Büro der Fabrik vorzufahren. Die Strecke führt durch Wälder zur Fabrik, die nahezu romantisch an einem Bach liegt. Das Wasser, das durch das Bachbett fließt, trieb hier vor 600 Jahren die ersten Mühlen an.
Ich bin an diesem Februarmorgen nicht der Einzige, der in der Firma vorstellig wird, um Arbeit zu finden, und so will ich durch meine Kleidung und mein Auftreten auffallen. Der Dame am Empfang sage ich: »Mein Name ist Frank K. Ich soll hier eingestellt werden.« – »Schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen«, sagt sie, als eine etwa 30-jährige Frau den Raum betritt, die von der Empfangsdame als Ehefrau des Inhabers begrüßt wird. Ich wende mich an sie: »Man hat mir gesagt, ich könnte hier sofort anfangen. Ich bin die 50 Kilometer von zu Hause mit dem Rennrad gefahren.« – »Mag schon sein. Aber ich habe zu tun.« Ich gebe trotzdem nicht auf. Jetzt oder nie! »Ich weiß ja, dass Sie eigentlich Jüngere suchen. Aber ich mache Triathlon, habe den Ironman geschafft: 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer auf dem Rad und den Marathon noch obendrein. Ich kann Ihnen ein sportärztliches Attest vorlegen, in dem mir das biologische Alter eines 30-Jährigen bescheinigt wird.« Ich habe mich vorbereitet und seit einigen Monaten reichlich Ausdauer- und sogar Krafttraining absolviert, dennoch übertreibe ich gewaltig. Bei meiner letzten Undercover-Recherche im Callcenter habe ich gelernt: »Den anderen nicht zu Wort kommen lassen! Gegenenergie aufbauen! Positive Bilder erzeugen! Auf den Abschluss drängen!« Ich sage also: »Ich kann ja die ersten Tage umsonst hier arbeiten. Sie gehen kein Risiko mit mir ein.«
Aus ihrem Gesicht ist jetzt so etwas wie Interesse zu lesen. Sie fragt: »Haben Sie schon mal im Schichtsystem gearbeitet?« – »Ja, am Fließband bei Ford und bei Siemens im Akkord.« Ich verschweige, dass das fast 40 Jahre zurückliegt. »Dann erscheinen Sie morgen zur Frühschicht.«
Ich bin drin. Ich beziehe noch am gleichen Tag Quartier bei einem Freund, der 35 Kilometer entfernt von der Fabrik wohnt, er überlässt mir ein Zimmer mit Schlafcouch.
Am ersten Morgen begrüßt mich die Chefin selbst mit Handschlag, dafür ohne Vertrag. Den gibt es weder heute noch später. Der übliche Stundenlohn beträgt hier 7,66 Euro brutto, ein Billiglohn also, netto bleiben den Arbeitern weniger als sechs Euro. Der Verdienst jedes fünften Vollzeitbeschäftigten in Deutschland liegt inzwischen unter der offiziellen Niedriglohnschwelle von weniger als 9,61 Euro im Westen beziehungsweise weniger als 6,81 Euro im Osten. Damit hat Deutschland einen höheren Anteil an Niedriglöhnern unter den Beschäftigten als Großbritannien und nur noch einen wenig geringeren als die USA.
Die Chefin überreicht mir eine weiße Arbeitshose und ein T-Shirt mit kurzen Ärmeln. Ich frage, ob man darin im Winter nicht friere. »Wenn es Ihnen zu kalt ist, müssen Sie eben schneller arbeiten.« Dann überlässt sie mich meinem Schicksal und meiner Schichtführerin.
Als ich ihr, einer Frau von Mitte 40, die Hand zur Begrüßung entgegenstrecke, ignoriert sie das, läuft an mir vorbei, als existiere ich nicht, zu einem Schaltkasten, dessen Knöpfe sie hektisch drückt. Auch die anderen Kollegen nehmen kaum Notiz von mir. Meine Schichtführerin platziert mich mit knappen Worten am Endband, wo schon zwei andere Arbeiter stehen. Insgesamt beschäftigt die Firma ungefähr 50 Menschen.
Am Endband strömen die Brötchentüten unentwegt mit immer gleicher Fließgeschwindigkeit der Mündung des Bandes entgegen. Die Packungen werden in Kartons verstaut und auf Paletten gestapelt. »Haltbarkeitsdatumsstempel kontrollieren, auf fehlerhafte Brötchen achten und sie aussortieren und die Packungen, die nicht prall genug mit CO₂ gefüllt sind, vom Band entfernen«, sagt der Kollege neben mir. Eine Aufgabe, die nicht fehlerfrei zu bewältigen ist.
Ich stehe gerade einmal eine Stunde am Band, da geht ein Geschrei los. Eine Sirene heult auf, und die Männer rennen fluchend in die Nebenhalle. Die Schichtführerin brüllt mich an, ich solle hinterher, »schnell, schnell, helfen, helfen!«, ruft sie und schubst mich. »Bleche vom Band runter, Tempo, Tempo!« Die Backbleche haben sich ineinander verkantet, aufgetürmt blockieren sie das Fließband. Unsere Aufgabe ist es, die heißen Bleche mit den herunterpurzelnden Brötchen vom Band zu nehmen und in fahrbare Gestelle zu schieben. Jedes Blech misst 80 mal 60 Zentimeter und ist mit 42 Brötchen beladen. Ein Kollege wirft mir ein paar zerfetzte Handschuhe zu, und ich verbrenne mir als Erstes die rechte Hand. Beim Hochstemmen der Bleche über Kopf zischt es auf der Haut meines rechten Arms, und es bilden sich dicke Brandblasen. Fast alle meine Kollegen, erfahre ich nach meinem Ausscheiden, haben sich schon einmal Brandverletzungen zugezogen.
TEIL 2
Als die stählerne Kette des Bandes plötzlich abspringt, herrscht Chaos. Die Kollegen brüllen sich an, greifen mit den Händen ins laufende Band, um die Kette wieder in die Halterung zu bringen. Dabei ist es schon zu Verletzungen gekommen, wie ich erst nach zwei Wochen erfahre, nachdem ich selbst schon mehrfach ins laufende Band gegriffen habe. Und erst nach einer Woche erfahre ich von einem Notstopp-Knopf, der seitlich vom Band angebracht ist. Aber den dürfen wir nur im alleräußersten Notfall betätigen, wissen die Kollegen. Denn wird er gedrückt, dann bleiben die Brötchen zu lange im Ofen, werden zu dunkel und sind nicht mehr verwendbar. Mit großem Nachdruck mahnt mich ein gelernter Bäckerkollege, die Finger von diesem Knopf zu lassen.
In den nächsten Arbeitstagen lerne ich, dass Störfälle bei Weinzheimer die Regel sind, nicht die Ausnahme. An manchen Tagen bricht alle 15 Minuten das Chaos aus: Bleche müssen vom Band, Brötchen fliegen durch die Luft und liegen auf dem Boden, wo wir sie aufsammeln müssen, damit sie später entsorgt werden. Die Bleche verziehen sich nämlich mit der Zeit in der Hitze des Ofens, und wenn sie sich verzogen haben, blockieren sie das Band, es kommt zu einem Stau, auch weil die Anlage mehr als marode ist. Es drohen dann Konventionalstrafen: Für jede nicht oder zu spät gelieferte Palette, bestehend aus 336 Brötchentüten, erfahre ich, muss Weinzheimer 150 Euro an Lidl zahlen. Ich höre, es seien kürzlich 87 Paletten gewesen, also rund 13000 Euro Strafe.
Ein Backblech kostet nur 70 Euro, und so frage ich einmal einen Schichtleiter, ob man denn nicht neue kaufen könne, um die dauernden Staus zu vermeiden. »Ihr seid billiger als neue Bleche«, ist seine Antwort.
Als am zweiten Tag das Band blockiert und die Brötchen herumfliegen wie Geschosse, stoße ich mich mit der Stirn an einem Blech. Es blutet stark, ich habe eine Risswunde, bin benommen. Später erfahre ich, dass einem Betriebsschlosser einige Monate zuvor an dieser Stelle das Gleiche passiert ist. Ich besuche ihn, und er erzählt mir: »Ich hatte eine stark blutende Schnittwunde und eine Gehirnerschütterung. Ich bat meinen Schichtführer, mir zu helfen, aber er sagte: Tut mir leid, keine Zeit für so was. Ich suchte selbst den Erste-Hilfe-Kasten, stellte jedoch fest, dass kein Verbandszeug drin war. Erst nach Schichtende wurde mir erlaubt, ins Krankenhaus zu fahren.«
Als das Band am dritten Tag für längere Zeit stillsteht, spricht mich der indischstämmige Kollege S. an. Er hält mich wegen meiner dunklen Haare für einen Landsmann oder einen Pakistaner. Ich muss ihn enttäuschen, bin aber froh, dass ich mit jemandem reden kann. S. ist sich, genau wie andere Kollegen, mit denen ich später spreche, sicher, dass das Betriebsklima sich drastisch verschlechtert hat, seitdem Lidl vor etwa sechs Jahren zum alleinigen Kunden wurde. Lidl verkauft eine Tüte mit zehn Brötchen für 1,05 Euro, Weinzheimer erhält ungefähr zwei Drittel, dafür muss die Firma frei Haus liefern.
Wie groß der Druck auf die Firma ist, lässt sich an einem Aushang erkennen, in dem sich der Firmenbesitzer an seine Arbeiter wendet, wortwörtlich wiedergegeben: »Bei Reklamationen seitens der Firma Lidl werden die Beträge jeweils an der nächsten Rechnung abgezogen. Dieses ist in dieser Woche der Fall, da über 150 Paletten, das sind anderthalb Tage Produktion oder 50000 Packungen schimmelig gemeldet wurden. Dieser Umstand ist für die Geschäftsleitung nicht vorhersehbar, aber nachvollziehbar. Der Schimmel entsteht durch unsauberes, ungenaues Arbeiten. Wenn ich sehe, wie die Räumlichkeiten und Maschinen nicht gereinigt werden und die Mitarbeiter meinen sich nicht an vorgeschriebene Prozesse halten zu müssen, aber dann ihrem Lohn hinterher jammern, den rate ich in Zukunft seine eigenes Handeln und den Umgang mit seinem eigenen Arbeitsplatz zu überdenken. Ich, die Firma Lidl und allen Endkunden habe für diese Arbeitsauffassung keinerlei Verständnis.«
Der Schimmel entsteht in der Brotfabrik keineswegs durch »ungenaues oder unsauberes Arbeiten«. Er blüht permanent – davon kann ich mich selbst überzeugen, und ich kann es auch durch Fotos belegen – an schwer zugänglichen Stellen der Anlage, rieselt er an verrotteten Eisenteilen herunter und entwickelt sich im Gärschrank. Ich selbst werde einmal mit einem älteren Kollegen dazu eingeteilt, den in den Fugen einer gekachelten Wand sitzenden Schwarzschimmel zu entfernen. Es ist eine mühselige Arbeit und eine vergebliche dazu – denn schon eine Woche später ist neuer Schimmel da. Als ich den älteren Kollegen frage, warum die Wand nicht fugenlos isoliert werde, um sie leichter und öfter zu reinigen, winkt der nur ab: »Natürlich könnte man hier vieles vorschlagen. Aber das ist unerwünscht. Ich habe einmal einen Vorschlag gemacht und danach nie wieder. Man sagte mir, ich sei zum Arbeiten hier, nicht zum Denken.«
Vordergründig wird in der Fabrik sehr auf Hygiene geachtet. Wir Arbeiter müssen eine Haube auf dem Haar tragen, und auch mein Schnauzbart wird von einer Binde geschützt. Wir müssen unsere Hände desinfizieren, bevor wir sterile Handschuhe anziehen. Aber in Wirklichkeit ist die Backanlage alles andere als steril: Weil sie so selten wie möglich stillstehen soll, wird sie nicht gründlich gereinigt. Der Boden ist immer wieder schmierig und verschmutzt.
Weinzheimer backt abwechselnd Ciabatta- und Körnerbrötchen für Lidl. Die Verpackung der Ciabatta-Brötchen suggeriert, dass sie aus Italien kommen, »Ital d’oro« steht darauf. Echter italienischer Ciabatta-Teig müsste etwa acht Stunden vorgären. Die Weinzheimer-Brötchen gären nur etwas mehr als eine Stunde vor. Werden sie nach einigen Wochen Lagerung aufgebacken, sind sie hart und knochentrocken. Der Begriff »Ciabatta« ist nicht geschützt, und so darf Weinzheimer seine Brötchen so nennen.
Jeder Arbeiter darf nach Schichtende eine Brötchentüte mit nach Hause nehmen. Die wenigsten machen von diesem Recht Gebrauch. Ein gelernter Bäcker aus der Teigmacherei sagte mir: »Meine Frau und meine Kinder weigern sich, die zu essen. Sie wollen frische Brötchen vom Bäcker.«
Ich frage mich, wer für das »Billig-billig-billig«-System von Lidl eigentlich hauptverantwortlich ist: Mit Billiglöhnen werden Billigbrötchen zu Billigpreisen und in Billigqualität an den Verbraucher gebracht. Warum kaufen die Kunden diese Brötchen, die nicht gut schmecken? Ja, sie sind in der Tat billig, zumindest auf den ersten Blick. Pro Brötchen zahlt der Kunde 10,5 Cent. Aber er muss immer gleich zehn kaufen. Er muss sie außerdem selbst aufbacken, was Zeit und Strom kostet. Vielleicht ist es verständlich, dass ein Hartz-IV-Empfänger solche Billigbrötchen kauft. Es wäre aber sicher ähnlich günstig, statt zu den Aufbackbrötchen zu gewöhnlichem Brot vom Bäcker um die Ecke zu greifen, der noch selber backt.
Die Zulieferfirmen für die großen Lebensmitteldiscounter – fünf von ihnen setzen in Europa 70 Prozent der Lebensmittel um – leiden unter einem krassen Preisdruck. Vor Kurzem hat das EU-Parlament in einer Resolution, die 439 Abgeordnete unterzeichneten, kritisiert, »dass große Supermärkte ihre Kaufkraft dazu missbrauchen, die an Zulieferer bezahlten Preise auf ein unhaltbares Niveau zu drücken und ihnen unfaire Bedingungen zu diktieren«. Der Preisdruck verschlechtere schließlich »die Arbeitsbedingungen bei den Zulieferern«. Wie groß die Zahl seiner Zulieferer ist, gibt Lidl nicht bekannt. Es sind sicher Hunderte – in den Filialen von Lidl gibt es mehr als 1500 Produkte zu kaufen.
An meinem vierten Tag erfahre ich plötzlich, dass ich erst mal nicht weiterarbeiten soll. Die Auftragslage sei im Moment nicht so günstig. Erst in einem Monat könne es möglicherweise weitergehen.
TEIL 3
Andere Kollegen wurden schon über Telefon informiert, die Schicht falle aus. Die freien Tage, die so entstehen, werden nicht bezahlt. Selbst Feiertage, auch Weihnachten und der 1. Mai, werden nicht entlohnt. Natürlich ist das illegal. Wer dagegen klagt – was einige Male geschah –, bekommt zwar vor Gericht recht. Aber er weiß, dass er seinen Arbeitsplatz riskiert. Wer seinen Job, auch wenn er mies ist, behalten will oder muss, hält den Mund und erduldet die Ungerechtigkeit. Er duldet auch, dass die Löhne häufig zu spät gezahlt werden – erst dann, wenn Lidl seine Monatsrechnung beglichen hat. Im vorigen Jahr kam das Geld für den November erst am 19. Dezember. Da hatten die ersten Arbeiter schon mit Pfändungen zu kämpfen. Wer von 7,66 Euro brutto pro Stunde lebt, hat ohnehin eher Schulden als Ersparnisse.
Um weiterarbeiten zu können, ersinne ich gemeinsam mit meinem Freund, dem Kabarettisten Heinrich Pachl, eine List: Fortan ist er mein Betreuer eines frei erfundenen EU-Programms »50 plus«, in dem ältere Arbeiter getreu der Devise »Erst fordern, dann fördern« unentgeltlich in Firmen arbeiten und dafür von der EU entlohnt werden.
Ich fürchte, die Geschichte könnte auffliegen. Eine Suche im Internet nach dem Namen meines Betreuers, er nennt sich Minsel, oder ein Anruf in Brüssel würden genügen. Aber Eigentümer und Betriebsleiter wollen die Sache offenbar allzu gerne glauben. Erfülle ich ihnen doch einen Traum: Ich bin ein Arbeiter, der keinen Cent kostet.
An einem der nächsten Tage lerne ich den Werksleiter K. näher kennen. Wieder einmal gilt es, Haufen von Brötchen unter dem laufenden Band aufzusammeln. Vom Boden bis zum Band sind es nur 60 Zentimeter, nicht viel Platz für einen ausgewachsenen Mann. K. fordert mich dennoch auf, unter das Band zu kriechen. »Das ist doch gefährlich. Kann ich das nicht machen, wenn das Band stillsteht?« – »Stellen Sie sich immer so dumm an?«, entgegnet K. »Passen Sie auf, ich mache Ihnen das jetzt mal vor.« K. ist ein Mann von erheblicher Fülle. Kaum hat er sich unter das Band begeben, gerät sein Kittel zwischen Kette und Zahnräder und wird mitgezogen. Mit einem Satz springe ich zu ihm, reiße mit voller Kraft an seinem Kittel und befreie ihn aus seiner misslichen Lage. K., blass geworden vor Schreck, bedankt sich nicht, sein Stolz verbietet es ihm offenbar. Das ölverschmierte Stück Stoff wirft er in eine Abfalltonne. Ich nehme es mir als Andenken wieder heraus.
Den großen Chef selbst, den Besitzer Bernd Westerhorstmann, sehe ich nur wenige Male durch den Betrieb gehen. Er würdigt die Arbeiter kaum eines Blickes. Stattdessen zeigt er mit dem Finger auf sie, wenn er etwas von ihnen will. So auch einmal auf mich. »Holen Sie die elektrische Ameise«, herrscht er mich an. Er meint damit einen Gabelstapler, den ich allerdings nicht ohne vorhergehende Einweisung fahren darf. Als ich ihn frage, wo das Gefährt zu finden sei, macht er eine abfällige Handbewegung und lässt mich stehen.
Westerhorstmann widmet sich ansonsten virtuell und aus der Ferne dem Geschehen in seiner Produktionsstätte. Denn das System Lidl hat Einzug gehalten in seine Backstraße. Westerhorstmann hat seine Hallen mit Kameras bestückt, auf deren Bilder er überall in der Welt via Internet und mit persönlichem Passwort zugreifen kann. Westerhorstmann stellt sogar nachts seine Allgegenwärtigkeit unter Beweis: Einmal hat er von zu Hause aus einer Schichtführerin eine Abmahnung erteilt. Denn er hatte über seine Kameras gesehen, dass sie statt einer weißen eine graue Arbeitshose trug.
Was treibt einen Menschen, eine Firma so zu führen? Ist es wirklich nur der Druck, der von Lidl kommt? Welchen Teil der Schuld trägt er selbst? Einige Arbeiter in der Fabrik glauben, dass er einzig daran interessiert sei, in der Zeit bis zu seinem Ruhestand das Maximum aus dem Betrieb herauszupressen, und kümmere sich deswegen weder um neue Maschinen noch um neue Bleche.
Vielleicht lässt sich aus seinem Umgang mit Tieren schließen, was für ein Mensch Westerhorstmann ist. Gleich neben der Fabrikhalle hält er etwa 20 afrikanische Buckelrinder. Im Betrieb heißt es, sein Vater, von dem er die Fabrik erbte, habe ihm die Pflege per Testament auferlegt. Sicher ist, dass die Tiere dort leiden, sie stehen bis über die Knöchel im eigenen Kot, weil niemand den Stall ausmistet. Eines Tages, es ist Karfreitag, entdecke ich, dass dort ein soeben geborenes Kalb liegt. Als ich es finde, hebe ich es aus dem Kot und Schlamm, trage es ins Freie und reibe es ab: Es lebt noch. Noch am selben Tag erfahre ich von einem Kollegen, dass das Neugeborene elendig verreckt ist.
Wie Westerhorstmann über die Gesundheit seiner Arbeiter denkt, ist ebenfalls einem Aushang zu entnehmen: »(Es) wird hier seit geraumer Zeit die Arbeitsauffassung durch Krankmeldungen ersetzt, so dass im Endeffekt die Mitarbeiter bestraft werden, die ihren Lohn durch ordentliche Arbeit erwirtschaften.« Das Gegenteil ist wahr: Die Arbeiter fürchten sich davor, sich krankzumelden, weil Westerhorstmann Krankheitstage häufig nicht bezahlt und weil er schon etliche Kranke aus dem Betrieb gemobbt hat.
Den vielleicht widerwärtigsten Fall von Mobbing erlebte ein Mann namens Ottmar Thiele. Er arbeitete seit 33 Jahren in der Firma, als der Chef ihn zwingen wollte, eine Änderungskündigung zu unterschreiben, die ihm 500 Euro weniger im Monat beschert hätte, dafür aber Schwerstarbeit im Schicht- und Nachtdienst. Obwohl Thiele nicht unterschrieb und trotz eines ärztlichen Attests, wonach ihm wegen einer Herzerkrankung weder Nacht- noch Spätschicht zugemutet werden dürfte, wurde er zum Schichtdienst gezwungen. Er wurde in die Produktion versetzt und musste schwere Paletten von Hand schieben. »Alles im Dauerlauf«, erzählt er heute. »Die wollten, dass ich von selbst gehe. Ich habe kaum noch geschlafen, Tag und Nacht an die Firma gedacht.«
Die Schikanen nahmen zu, er erhielt konstruierte Abmahnungen, und als er vor dem Arbeitsgericht klagte, erteilte man ihm Hausverbot. »Die Chefsekretärin kam morgens in die Werkstatt, verlangte meine Stempelkarte und meine Schlüssel. Doch kaum war ich zu Hause, rief der Betriebsleiter an, ich müsse am nächsten Tag wieder zur Spätschicht antreten. Ich bekam dann nach vier Stunden härtester Arbeit plötzlich keine Luft mehr, hatte panische Angst, und das Herz krampfte sich zusammen. Ich musste zum Arzt.«
Nach einjährigem Prozess kommt Thiele endlich zu seinem Recht. Die Änderungskündigung ist unbegründet und unwirksam. Der Fabrikant hat dennoch seinen Sieg errungen: Thiele verzichtet darauf, wieder eingestellt zu werden, und gibt sich mit einer siebenmonatigen Gehaltsnachzahlung zufrieden, nachdem der gegnerische Anwalt vor Gericht suggeriert hat, dem Betrieb stehe womöglich ein Insolvenzverfahren bevor.
»Was wäre die gerechte Strafe für so einen Unternehmer?«, frage ich Ottmar Thiele. »Es müsste ein Gesetz geben, dass so ein Mann mindestens acht Wochen in der Produktion arbeitet, unter den Bedingungen, die er vorgibt«, antwortet er.
TEIL 4
Eine fristlose Kündigung ohne Vorwarnung und ohne ersichtlichen Grund traf schließlich auch einen früheren Betriebsleiter. Als er auf Wiedereinstellung klagte, schickte der Brötchenfabrikant den neuen Werksleiter und seine Betriebsrätin zu den Mitarbeitern. Sie sollten mit ihrer Unterschrift bekunden, dass sie die Arbeit niederlegen würden, sollte der Gefeuerte wieder eingestellt werden. Einem Schlosser, der seine Unterschrift verweigerte, wurde gedroht, er werde entlassen, falls man den Geächteten wieder einstellen müsse.
Meinen schwärzesten Tag habe ich nach etwa zwei Wochen. Es ist mein Kollege S., der mich rettet, denn ich breche fast zusammen. Ich höre, wie mein Herz schlägt, laut und rasend und unregelmäßig. Herzrhythmusstörungen. Ich erkenne sie gleich, weil ich sie schon einmal erlebt habe: vor 15 Jahren, als ich mit dem Kajak auf dem Atlantik in Seenot geriet. Ein Sturm trieb mich aufs offene Meer, ich verlor das Land aus den Augen. So fühle ich mich jetzt auch: Ich sehe kein Land mehr. S. muss merken, wie schlecht es mir geht. Er übernimmt, ohne ein Wort darüber zu verlieren, einen Teil meiner Arbeit.
Nach diesem Tag kommt mir das Wort »Streik« in den Kopf. Ich summe während der Arbeit die Internationale, die Hymne der Arbeiterbewegung, darauf vertrauend, dass kein Vorgesetzter die Melodie kennt und den zugehörigen Text: »Wacht auf, Verdammte dieser Erde...« Ein junger Kollege zwinkert mir zu, schaut sich um, ob ihn auch keiner sieht, und hebt die zur Faust geballte Hand.
Die Schichtführerin der ersten Tage hat sich gewandelt: Sie schreit uns nicht mehr an, ist in sich gekehrt, geradezu verunsichert. Sie ist abgemahnt und zur einfachen Arbeiterin degradiert worden, erfahre ich, weil sie angeblich zu wenig Leistung bringt. Die Firma verschleißt die Leute, und wer verschlissen ist, dessen Tage sind gezählt. Jeder kann in diesem System zum Opfer werden. Es geht ganz schnell.
Und so spreche ich sie eines Morgens an, da ich denke, dass der Gedanke bei ihr auf fruchtbaren Boden fallen könnte: »Eigentlich müsste hier doch mal gestreikt werden.« Sie sieht mich erschrocken an: »Um Gottes willen, sagen Sie so etwas nicht! Es haben ja schon mal welche versucht, einen Betriebsrat zu gründen. Die sind alle raus, die sind alle weg.« Schnell wendet sie sich von mir ab. Die Angst unter den Geschundenen ist so groß, dass selbst der Gedanke an ein Aufbegehren sie schreckt.
Der bislang einzige Versuch, einen Betriebsrat zu gründen, fand im Frühjahr 2007 statt. Wie in fast allen Lidl-Filialen gab es bis dahin auch beim Lieferanten Weinzheimer keinen Betriebsrat. Eine Gruppe Arbeiter beschloss, das zu ändern. Als Weinzheimer davon erfuhr, drohte er damit, die Fabrik zu schließen oder wenigstens einen Teil der Arbeiter zu entlassen. Wegen »betriebsbedingter Teilautomatisierung«.
Eine erste Betriebsversammlung geriet zum Fiasko. Als ein Arbeiter kritisierte, dass er 20 Tage am Stück arbeiten musste, entgegnete ihm Westerhorstmann: Dafür gibt es ja auch mal zwei Wochen lang gar nichts zu tun! Als die Kollegen darauf mit weiterer Kritik reagierten, warf Westerhorstmann sie kurzerhand mit der Begründung aus dem Saal, er mache von seinem Hausrecht Gebrauch. In der Folge drohte er Kollegen, sie zu entlassen, wenn sie sich an einer Betriebsratswahl beteiligten.
Schließlich fand die Wahl dennoch statt. Alban Ademaj, 25 Jahre alt, wurde an die Spitze des Betriebsrates gewählt. Er konnte sein Amt nie wirklich ausüben. Seine Bitte, doch endlich den Arbeitern ihre Stundennachweise auszuhändigen, wurde abgelehnt. »Viele hatten den Verdacht, dass der Betriebsleiter Stunden unterschlägt. Er konnte die Zahl der Arbeitsstunden am Computer manipulieren. Ich konnte ihn dabei überführen, da ich meine Stunden aufgeschrieben hatte«, sagt Ademaj heute.
Nach seiner Wahl wurde er, der zuvor nie Anlass zur Beschwerde geboten hatte, andauernd abgemahnt, bis er schließlich aufgab. »Ich dachte, wenn ich zurücktrete, lässt mich Westerhorstmann wenigstens wieder in Ruhe meine Arbeit machen.« Er irrte sich. Er wurde ans Endband versetzt, um die Tüten zu kontrollieren, jene Arbeit, bei der man zwangsläufig Fehler macht. Ständig wurden Ademajs Paletten kontrolliert. Als man ihm auch bei der vierten Kontrolle nichts nachweisen konnte, stellte man ihm einen Neuling zur Seite und lastete dessen Fehler schließlich Ademaj an.
Später sollte Ademaj angeblich zu wenige Paletten bestückt haben, obwohl er zu diesem Zeitpunkt in der Teigmacherei arbeitete. Zum Verhängnis wurde ihm unter anderem eine Tüte mit lebenden Kakerlaken. Ein Kollege hatte die Tierchen eingesammelt und neben seinen Arbeitsplatz gestellt. Ademaj sah die Tüte und versteckte sie, weil er fand, sie sollte einem Lidl-Kontrolleur, der für diese Zeit erwartet wurde, nicht ins Auge fallen. Ademaj bekam auch wegen dieser Tüte eine Abmahnung und wurde schließlich fristlos entlassen.
Ich erlebe Ademaj noch als Kollegen. Als er plötzlich vom einen auf den anderen Tag nicht mehr erscheint, ist das kein Thema im Betrieb. Keiner wagt, offen darüber zu reden.
Auch der Nachfolger Ademajs wurde schließlich fristlos entlassen, diesmal mit dem Zusatz: »Die Zustimmung des Betriebsrates liegt vor.« Denn mittlerweile war die nur an sechster Stelle gewählte Chefsekretärin zur Betriebsratsvorsitzenden aufgestiegen. Sie ist eine Betriebsratsvorsitzende von Westerhorstmanns Gnaden. Seitdem sie im Amt ist, gibt es keine Opposition mehr in der Fabrik.
Kein Wunder also, dass Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit keine Rolle spielen. Eine meiner Hauptaufgaben besteht darin, stundenlang fehlerhafte Tüten aufzuschlitzen und die Brötchen wieder aufs Band zu kippen. Diese Tüten sind nicht mit Luft, sondern mit Kohlendioxid prall gefüllt, sodass ich diesem Gas, das nur in geringer Konzentration harmlos ist, schutzlos ausgesetzt bin. Schon nach kürzester Zeit verursacht diese Arbeit Kopfschmerzen. Die Augen brennen, die Kehle trocknet aus. Ich bin benommen, sehne mich nach Frischluft, aber die gibt es hier nicht.
TEIL 5
An einem Tag, als ich wieder stundenlang Tüten aufschlitzen muss, werde ich, klatschnass geschwitzt, nach draußen abkommandiert, im dünnen Hemd. Ich soll zwei Stunden lang Abfallbrötchen in Container kippen. Es ist Ende Februar, es herrschen Minusgrade, und ich fürchte, mir eine Lungenentzündung zu holen.
Also betrete ich in meiner Not das Büro und bitte die Frau des Besitzers, mir doch einen Kittel gegen die Kälte zu geben. Anstatt sich um meine Gesundheit oder wenigstens meine Arbeitskraft zu sorgen, sagt sie: »Ich könnte Ihnen jetzt sofort eine Abmahnung erteilen! Sie dürfen in Ihrer sterilen Kleidung die Halle gar nicht verlassen.« – »Aber man hat mich doch rausgeschickt.« – »Sie haben sich an die Vorschriften zu halten.« Die folgenden zwei Stunden schaut sie mir von ihrem Büro aus zu, ungerührten Blickes, wie ich im dünnen Hemd in eisiger Kälte ihre mistigen Brötchen verklappe.
Zahlreich sind die Berichte solcher gesundheitsgefährdender Einsätze: Zwei Kollegen müssen ohne ausreichenden Atemschutz mit alter Glaswolle einen Backofen isolieren – diese Fasern sind stark krebserregend. Ein Schlosser wird aufgefordert, in einem Mehlsilo zu schweißen – ein einziger Funke kann dort eine Verpuffung oder eine Explosion auslösen. Nur mit Mühe kann er sich widersetzen.
An meinem letzten Arbeitstag stattet der »EU-Beauftragte«, mein Freund Pachl, samt Delegation dem Betrieb einen Besuch ab. K., der Werksleiter, gibt dem vermeintlichen EU-Beamten gleich zweimal zu verstehen, ich sei nicht »intrigierbar«. Ich nehme an, er meint: integrierbar, was ich als Kompliment verstehe. Ich bin K. nicht geheuer. Vielleicht ist ihm zugetragen worden, dass ich dem ein oder anderen Kollegen kritische Fragen gestellt und auch meine Meinung offen vertreten habe.
Ich gebe K. beim Abschied die Hand: »Vielen Dank für alles, ich habe viel gelernt hier und werde von mir hören lassen.« K. sagt nichts, sondern knurrt nur etwas, dann heult schon wieder die Alarmsirene, und er eilt zum Kühler, der wieder mal blockiert.
Einen Monat lang habe ich in der Brötchenhölle ausgehalten. Dabei habe ich fünf Kilo abgenommen. In den ersten Tagen danach bin ich einfach nur froh, es hinter mir zu haben, und habe dennoch gegenüber meinen Kollegen, die ich zurückließ und denen ich mich nicht zu erkennen geben durfte, ein schlechtes Gewissen. Eine Szene, kurz vor meinem Weggang, ist mir seither oft vor Augen: Ein neuer Arbeiter steht in der Halle, allein, verzweifelt, er schreit, weil er sich verbrannt hat. Er hat keine Ahnung, was er tun kann, niemand hilft ihm, auch keiner der Kollegen. Genauso stand ich am ersten Tag in der Halle. Nur dass für mich der Albtraum immer ein absehbares Ende hatte, für ihn nicht. Für ihn währt dieser Albtraum wahrscheinlich noch heute.
Was ist meine Hoffnung? Dass der Konsument, dass wir alle unsere Macht erkennen. Die Arbeiter können sich selbst nicht mehr helfen in diesem Betrieb, jedes Aufbegehren wird brutal unterdrückt. Eine realistische Hoffnung? Durchaus, denke ich. Es waren die Kunden der Biomarktkette Basic, die im vorigen Jahr verhindert haben, dass Lidl das Unternehmen kaufen konnte – indem sie mit einem Boykott drohten. Nun sollten die Kunden Lidl und seinem System ein weiteres Mal widersprechen. Lidl diktiert Weinzheimer die Preise und trägt damit Verantwortung dafür, wie Menschen dort arbeiten müssen. Solange die Arbeiterrechte dort systematisch verletzt werden, sollten die Kunden Lidl und seine dürftigen Brötchen boykottieren.
Der Firmenbesitzer Bernd Westerhorstmann wurde mit Vorwürfen aus diesem Artikel konfrontiert. Eine angekündigte Antwort blieb bis zum Redaktionsschluss aus.
Günter Wallraff ist Undercover-Journalist und Schriftsteller. Vor einem Jahr arbeitete er als verdeckter Mitarbeiter in Call-Centern. Seine Reportage im ZEIT-Magazin (Nr. 22/07) löste eine Gesetzesinitiative aus, wonach Kunden vor unerwünschten Werbeanrufen besser geschützt werden sollen. Bekannt wurde Günter Wallraff durch seine Industriereportagen und sein Buch »Ganz unten« (1985)
Der im ZEIT-Magazin angekündigte Ausschnitt eines Filmbeitrags über Wallraffs Recherche entfällt bis auf weiteres. Wir bitten das zu entschuldigen.
Zu Günter Wallraffs Recherche erscheint auch eine DVD bei Captator Film (info@captatorfilms.com)
skip to main |
skip to sidebar
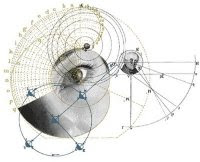
Labels
- ABN Amro (8)
- Adidas (1)
- Ageing population (1)
- Alice Schwarzer (2)
- Alkoholmissbrauch (1)
- Arbeitslosengeld I (4)
- Austria (1)
- Autoindustrie (9)
- Autos (5)
- Bafög (1)
- Bahnstreik (1)
- Betreuungsgeld (3)
- Bono (2)
- CDU (3)
- CeBIT (3)
- CeBIT 2008 (4)
- Chinapolitik (2)
- Christian Social Union (CSU) (1)
- Climate Change (3)
- Danone (1)
- Data (1)
- Deutsche Bahn (18)
- Deutsche Bank (2)
- Deutsche Literatur (1)
- Deutsche Post (3)
- Deutsche Telekom (16)
- Deutschpop (2)
- Die Linke (4)
- die Linkspartei (4)
- Die rot-grünen Jahre (1)
- E-learning (1)
- Employment (1)
- Entsendegesetz (1)
- Erich Kästner (1)
- European Union (19)
- Export model (1)
- Feminismus (2)
- Finanzkrise (1)
- France and Germany (1)
- Frankfurter Buchmesse (1)
- Franz Müntefering (3)
- Frauen (1)
- G8 (27)
- G8-reform (2)
- GDL (1)
- Georg-Büchner-Preis (1)
- German armed forces (1)
- German banks (3)
- German engineering companies (1)
- German history (3)
- German investors in Russia (1)
- German Politics (26)
- German trade unions (1)
- German unemployment (1)
- German unification (1)
- Germany in recession (2)
- Germany's biggest-ever tax-evasion scandal (3)
- Germany’s economic downturn (2)
- Germany’s economic upswing (33)
- Germany's government (1)
- Germany's Landesbanken (1)
- Germany's newest high-technology industries (1)
- Germany's Social Democrats (1)
- Global Terror (1)
- Globalisierung (5)
- Grand coalition (3)
- Green Germany (1)
- Große Koalition (3)
- Grünen (11)
- Günter Grass (1)
- Günter Wallraff (2)
- Hamburg (2)
- Haushaltsdebatte 2008 (7)
- Health reform (1)
- Hirsi Ali (1)
- Holiday at home (1)
- IFA (1)
- Illegal migration (1)
- Iron Cross (1)
- IT (1)
- Joschka Fischer (3)
- Jugendgewalt (2)
- Karl Valentin (1)
- Kinder und Eltern (5)
- Konkret (1)
- Kultur (1)
- Kunst (1)
- Kurt Beck (6)
- Landtagswahlen 2008 (4)
- Leipzig (1)
- Liechtenstein-Affäre (1)
- Linkspartei (2)
- Marx (1)
- Medien (4)
- Merkel (29)
- Merkels Besuch in Israel (3)
- Merrill Lynch (1)
- Mindestlohn (13)
- Mittelstand (1)
- Mode (1)
- Nokia-Werksschließung (9)
- Numico (1)
- Öko-Industrie (1)
- Orange (1)
- Pflegebeitrag (1)
- Politische Linke (1)
- Porsche (10)
- Potsdam (1)
- Projekt Gutenberg-DE (1)
- Punk (1)
- Recession (2)
- Red (1)
- Regulations (1)
- Rente mit 67 (1)
- Romantik (1)
- Rot-rot-grüne Koalition (1)
- Rote Armee Fraktion (24)
- SAG (1)
- SAP (3)
- Schule (4)
- Schwarz-Grün (1)
- Seedcamp (1)
- Siemens (23)
- Simone de Beauvoir (1)
- small and medium-sized -concerns (1)
- Software AG (2)
- Solar Valley (1)
- Sozialdemokratie (2)
- SPD (19)
- SPD Kurswechsel (4)
- SPD-Bundesparteitag in Hamburg (12)
- Stefan George (1)
- Steuerreform (3)
- Steuerskandal (1)
- Strategie Trends (1)
- The Left Party (1)
- The Weimar Republic (2)
- Threat of terrorist attacks (1)
- TNT (1)
- Tokio Hotel (1)
- Trends (2)
- U2 (1)
- Unternehmen (11)
- Verhältnis zwischen Deutschland und Amerika (1)
- Volkswagen (11)
- Wirtschaftspolitik (1)
- Wolf Biermann (1)
- Zumwinkel (3)
About Me
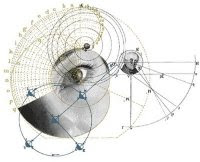
- Albert van Grondelle
- Informatieprofessional gespecialiseerd in het organiseren van content, kennis en samenwerking(collaboration) in de onderneming.

