SPD: Michael Naumann über die Krise der Partei | ZEIT online
Wohin treibt die SPD?
Von Michael Naumann | © DIE ZEIT, 27.03.2008 Nr. 14
Schlagworte: Kurs SPD Partei Innenpolitik
Die Sozialdemokraten müssen der Linkspartei eine klare Absage erteilen und sich zur Reformpolitik Gerhard Schröders bekennen. Den Kanzlerkandidaten sollten sie per Urwahl nominieren
Demokratische Politiker sollen das Land oder ihre Partei nach Maßgabe ihrer Verfassung und Satzung führen. Die Gestaltungsmacht, die ihnen im wahrsten Sinne des Wortes »anvertraut« wird, gründet auf der Fähigkeit der Politiker, die Wähler von der Richtigkeit ihrer Pläne zu überzeugen. Ändert ein Politiker seine Ansichten oder stellt er seine Wahlversprechen infrage, muss er sich bei Strafe von Ansehensverlust und Machtentzug erklären.
Wie die Wähler wünschen sich auch die Parteimitglieder und ihre Delegierten in den Parlamenten gut begründete »Führung« – nur über die Richtung sind sie sich nicht immer einig. In einer Programmpartei kann derlei Uneinigkeit zur Zerreißprobe führen. Und in der befindet sich die SPD. Zwar hat sie sich jüngst auf ihrem Parteitag in Hamburg ein behutsames Programm gegeben, das keine Wählerschicht erschrecken muss, doch hat sie sich durch die Freigabe von Koalitionsoptionen mit der Linkspartei Oskar Lafontaines und Gregor Gysis auf Landes- und Kommunalebene in eine Vertrauens- und Identitätskrise manövriert. Das hat historische Gründe.
Keine andere deutsche Partei kann auf Tausende Mitglieder verweisen, die für ihre Ideale mit Gefangenschaft und Exil oder gar mit ihrem Leben bezahlt haben – und zwar nicht erst seit den Verfolgungen im Kaiserreich, nicht erst seit 1933, sondern auch nach 1945 im Herrschaftsbereich der UdSSR und ihrer ostdeutschen Verbündeten. Ihre antifaschistische und antikommunistische Standhaftigkeit, oft auf die Probe gestellt, war und ist das moralisch-historische Kraftzentrum der SPD. Sie ist immer eine Partei der Freiheit geblieben.
Wie soll sie sich verhalten angesichts einer Partei kommunistischen Ursprungs, der ehemaligen PDS also, deren Führung offenbar nichts dagegen hat, dass marxistisch-leninistische DKP-Mitglieder auf ihren Wahllisten kandidieren? Wie soll die SPD mit dem Sachverhalt umgehen, dass »Die Linke« in Ostdeutschland zur größten Partei heranwächst und in Westdeutschland in immer mehr Parlamente einzieht?
Der Präsidiumsbeschluss der SPD, zwar auf Bundesebene mit der »Linken« nicht zu paktieren, auf Landes- und Kommunalebene aber Tolerierungs- und Koalitionsmöglichkeiten offenzulassen, ist im Kern paradox, weil er legitime Machtkalküle mit programmatischer Standhaftigkeit zu versöhnen sucht. Gleichzeitig bestätigt er die Praxis entsprechender Koalitionen in Ostdeutschland und in Berlin. Und er ebnet ganz nebenbei den Weg für Klaus Wowereit. Jedermann in der SPD ahnt, dass der tüchtige Regierende Bürgermeister Berlins spätestens im Jahr 2013 mit den Stimmen der »Linken« zum Bundeskanzler gewählt werden möchte.
Freilich steht dem ehrgeizigen Plan nicht nur der rechte Flügel der SPD entgegen, sondern auch die Macht-Schachspielerin Angela Merkel. Ihr ist zuzutrauen, dass sie den inneren Konflikt ihres Regierungspartners kühlen Herzens ausnutzt. Irgendein von der Union inszenierter legislativer Brandbeschleuniger – ein finaler Koalitionskonflikt noch in diesem Jahr – könnte alle sozialdemokratischen Kanzlerträume für die nähere Zukunft auslöschen.
Was tun? Statt sich in Koalitionsspekulationen mit der »Linken« aufzuhalten, sollte sich die SPD um deren Wähler kümmern: In Hamburg waren es nicht nur Protestwähler (über 10000 ehemalige Schill-Anhänger), sondern auch Arbeitslose, enttäuschte Grüne, Gewerkschafter und zornige ehemalige Sozialdemokraten, die der sogenannten »Hartz-Partei« Schaden zufügen wollten – was gelang. Nicht anders war es in Niedersachsen und Hessen. Der Kampf um diese Wähler muss der SPD eigentlich leichtfallen. Gleichzeitig gilt es (auch für die Union!), die Nichtwähler – bei Landtagswahlen sind das fast 40 Prozent – zu mobilisieren. Immer noch lebt »Die Linke« von deren Gnade. Die allgemeine politische Abstinenzbewegung senkt die Fünfprozenthürde für Splitterparteien.
Die SPD mag derzeit nicht genau wissen, wo sie hinwill, aber sie weiß, wo sie herkommt. Sie ist immer noch auf die republikanischen Ideale von Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit für alle verpflichtet. Sie setzt weiterhin auf die Emanzipation jener Deutschen, die aufgrund ihrer Herkunft, ihres Berufsschicksals, ihres Alters und Geschlechts oder ihrer Hautfarbe unter allfälligen sozialen, kulturellen und distributiven Ungerechtigkeiten zu leiden haben. Es gibt sie, und niemand wird mehr wie Helmut Kohl behaupten können, die »Deutschen jammern auf hohem Niveau«. Es ist für die meisten gesunken. Hierin sieht »Die Linke« ihre Chance. Ihr »Hauptgegner«, so eine ihrer Spitzenkandidatinnen, ist »die SPD«, genauer, die Agenda-Politik der Regierung Gerhard Schröders. Wenn die SPD dieses Erbe nicht annimmt, räumt sie der »Linken« das Feld.
Doch wer die Agenda-Politik verstehen will, sollte sich an die letzten Jahre der Kohl-Regierung erinnern: Die Jahre des kontinuierlichen Wachstums und der Vollbeschäftigung liefen Ende des 20. Jahrhunderts bereits aus, als die Wiedervereinigung die ganze Nation auf die größte finanz- und wirtschaftspolitische Probe stellte. Jährlich wurden über 60 Milliarden Euro Steuergelder in die neuen Länder transferiert (die hauptsächlich in Konsumausgaben flossen, Renten inklusive). Das war und ist ein bemerkenswerter nationaler Solidarakt, allerdings zum Nachteil des gesamtdeutschen Wirtschaftswachstums – und des komplexen Sozialsystems, das an seine Grenzen geriet.
Als nach Jahren unsolider Haushaltspolitik ausgerechnet der sozialdemokratische Bundeskanzler Gerhard Schröder den Kohlschen Reformstau nach einigem Zögern mit robusten ökonomischen Impulsgesetzen auflöste, ging die innere ideologische Balance der SPD verloren. Dabei kann es bei aller Kritik heute keinen Zweifel mehr daran geben, dass diese Politik gegriffen hat – binnen dreier Jahre wuchs das Bruttoinlandsprodukt nach Jahren der Stagnation um sieben Prozent, eine Million neuer Arbeitsplätze entstanden. Zu spät.
Die Reformen des Sozialsystems galten als kaltherziger Abschied von sozialdemokratischer Gesinnungstreue. Das Gegenteil war der Fall: Wirtschaftsförderung bei gleichzeitiger Rettung eines finanziell maroden Sozialsystems gehorchte der banalen Tatsache, dass nur verteilt werden kann, was erwirtschaftet worden ist. Alles, was darüber hinausging, scheiterte an der europäischen Staatsverschuldungsgrenze.
Weil sich nach der verlorenen Landtagswahl von Nordrhein-Westfalen mehr als 20 sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete von der Agenda-Politik Schröders abwandten, kam es 2005 zu Neuwahlen. Die SPD-internen Flügelkämpfe gingen weiter. Die schwächelnden Funktionärseliten einiger Gewerkschaften, an der Spitze die IG Metall, usurpierten die sozialen Traditionspositionen der Sozialdemokratie.
Minijobs oder Zeitarbeit sind besser als gar keine Beschäftigung
Der ungerechteste Vorwurf der Gewerkschaften an die SPD lautet heute, dass die negative Lohnentwicklung in Deutschland »politisch gewollt war« (so eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans Böckler Stiftung). Das war sie nicht – wenngleich eines gewiss stimmt: Diese Lohnentwicklung hinkt weiterhin der Produktivitätssteigerung hinterher. Tatsächlich sind Minijobs, Zeitarbeitsverträge, Ich-AGs und Ein-Euro-Jobs von der rot-grünen Koalition gefördert worden. Und zweifellos wirkte diese neue Arbeitswelt wie ein lohndrückender Faktor auf die Einkommensentwicklung. Aber was sonst hätte die Regierung machen können? Die Arbeitslosigkeit hatte sozialstaatlich nicht mehr bezahlbare Rekordhöhen erreicht – und für den Einzelnen war irgendeine Beschäftigung immer noch besser als gar keine.
Dass heute ausgerechnet die Partei Lafontaines und Gysis politischer Nutznießer der Arbeitsmarkt-Turbulenzen ist, entbehrt nicht tieferer Ironie: In ihrem sozialistischen Weltbild der korrekt organisierten Gesellschaft kommt Arbeitslosigkeit nicht vor. Heute fordern Mitglieder der Linkspartei, alle Arbeitslosen vom Staat beschäftigen zu lassen. Das Projekt war in der DDR bereits gescheitert.
Diese Partei ist nicht koalitionsfähig für Sozialdemokraten. Ihre Gesetzesanträge im Bundestag addieren sich auf 150 Milliarden Euro zusätzlicher Ausgaben. Sie lehnt den EU-Vertrag ebenso ab wie die Mitgliedschaft in der Nato, sie pocht auf die Legitimationsgrundlagen von UN-Beschlüssen bei Militärinterventionen im Ausland – und will dennoch die mandatierten Truppen der Bundeswehr aus dem Ausland zurückziehen. Ihr Parteivorsitzender Lafontaine hält den venezolanischen Links-Caudillo Hugo Chávez für eine Respektsperson, und zu den Vorgängen in Tibet wird man noch lange nichts von ihm hören.
Wenn Beck sich nicht sicher ist, sollen die Mitglieder entscheiden
Statt also mit der Partei des Racheengels Lafontaine zu liebäugeln, wäre die SPD besser beraten, ihre Regierungsarbeit in der Großen Koalition offensiver als bisher zu präsentieren: Steigerung der Arbeitsplätze auf Rekordniveau aufgrund eines 25-Milliarden-Euro-Impulsprogramms, niedrigere Sozialabgaben, sechs Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung, Verbesserung der Pflegeversicherung, moderate Anpassung der Rentenbezüge – bis hin zur Konsolidierung des Haushalts unter der Ägide von Peer Steinbrück.
Doch von Stolz auf das Erreichte ist die SPD weiter denn je entfernt. Wer ihre Gemütslage verstehen will, kann sie als Widerspiegelung einer Ordnungskrise interpretieren, die sämtliche Großorganisationen erfasst hat. Die Mitgliedschaften lösen sich auf, die Fragmentierung der Gesellschaft in Gruppen mit ausgeprägten Partikularinteressen schreitet fort. Eine diffuse Unzufriedenheit der Bürger mit dem Staat schlägt sich nieder in Wahlenthaltung und Glaubwürdigkeitsverlusten der Eliten. Insofern entspricht die Hoffnung der Sozialdemokraten auf neue Führung der Erwartung im Land, ein Politiker möge die Gesellschaft aus allerlei Nöten in ruhigere Gefilde führen – jenseits von Abstiegsängsten und drohender Arbeitslosigkeit. Doch im Labyrinth der globalisierten Moderne gibt es keinen geraden Weg mehr, der zu einem Ausgang in gesicherten Wohlstand führte.
Was also soll die SPD, was soll der Parteivorsitzende machen? Zuerst einmal gilt es, Vertrauen in der Mitte der Gesellschaft zurückzuerobern. Das bedeutet: in Westdeutschland eine klare Absage an zukünftige Tolerierungs- oder Koalitionsabkommen mit der »Linken« auf allen Ebenen – bei Strafe von Stimmenverlusten in der bürgerlichen Wählerschaft. Das Gespräch mit den Gewerkschaften muss neu belebt werden. Während die SPD das Projekt des flächendeckenden Mindestlohns verfolgt, besinnen sich einzelne Gewerkschaften schon wieder eines anderen. Doch es gehört zu Recht in den Forderungskatalog der Sozialdemokratie, um eine moralische Komponente in die Realität menschenunwürdigen Lohndumpings einzuführen.
Die SPD wird sich einmal mehr neu formieren müssen als offenes, tolerantes Diskussionsforum. Die hämischen Kommentare der Union und ihrer medialen Freunde wird sie ertragen müssen. Einsame Entscheidungen an der Parteispitze wird es nicht mehr geben können. Doch die Diskutanten sollten gleichzeitig anerkennen, dass sich das Führungspersonal aller Parteien in einer neuen Öffentlichkeit bewegt. Seit Jahren schon haben die Medien den theatralischen Aspekt aller Politik für sich entdeckt: Politische Berichterstattung in den Massenmedien hat die Grenzen zur Sportreportage überschritten.
Was die SPD sich nicht leisten kann, ist eine Personaldebatte um die Zukunft des Parteivorsitzes und der Kanzlerkandidatur, die sich abhängig macht von aktuellen Meinungsumfragen und Stimmungsbarometern. Die Sozialdemokraten und ihr Vorsitzender müssen ihrer eigenen Geschichte treu bleiben. Sie sollten sich daran erinnern, dass die SPD alle »linken« Abspaltungen überlebte, weil sie die besseren Argumente hatte.
Und wenn sich der Parteivorsitzende seiner Kanzlerkandidatur nicht sicher ist, kann er auf das Mittel zurückgreifen, das einem seiner Vorgänger, Rudolf Scharping, in der Stunde politischer Not zur Verfügung stand: Er kann sich in einer Mitgliederumfrage zur Wahl stellen. Freilich ist das nur sinnvoll, wenn sich ein Gegenkandidat meldet. So viel Demokratie muss in Willy Brandts SPD gewagt werden. Ein historischer Trost für beide Kandidaten stünde jetzt bereits fest. Der damalige Verlierer, Gerhard Schröder, erhielt eine zweite Chance, die er dann auch nutzte. Sein falscher Freund Oskar Lafontaine hat ihm das nie verziehen.
skip to main |
skip to sidebar
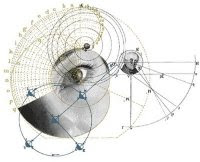
Labels
- ABN Amro (8)
- Adidas (1)
- Ageing population (1)
- Alice Schwarzer (2)
- Alkoholmissbrauch (1)
- Arbeitslosengeld I (4)
- Austria (1)
- Autoindustrie (9)
- Autos (5)
- Bafög (1)
- Bahnstreik (1)
- Betreuungsgeld (3)
- Bono (2)
- CDU (3)
- CeBIT (3)
- CeBIT 2008 (4)
- Chinapolitik (2)
- Christian Social Union (CSU) (1)
- Climate Change (3)
- Danone (1)
- Data (1)
- Deutsche Bahn (18)
- Deutsche Bank (2)
- Deutsche Literatur (1)
- Deutsche Post (3)
- Deutsche Telekom (16)
- Deutschpop (2)
- Die Linke (4)
- die Linkspartei (4)
- Die rot-grünen Jahre (1)
- E-learning (1)
- Employment (1)
- Entsendegesetz (1)
- Erich Kästner (1)
- European Union (19)
- Export model (1)
- Feminismus (2)
- Finanzkrise (1)
- France and Germany (1)
- Frankfurter Buchmesse (1)
- Franz Müntefering (3)
- Frauen (1)
- G8 (27)
- G8-reform (2)
- GDL (1)
- Georg-Büchner-Preis (1)
- German armed forces (1)
- German banks (3)
- German engineering companies (1)
- German history (3)
- German investors in Russia (1)
- German Politics (26)
- German trade unions (1)
- German unemployment (1)
- German unification (1)
- Germany in recession (2)
- Germany's biggest-ever tax-evasion scandal (3)
- Germany’s economic downturn (2)
- Germany’s economic upswing (33)
- Germany's government (1)
- Germany's Landesbanken (1)
- Germany's newest high-technology industries (1)
- Germany's Social Democrats (1)
- Global Terror (1)
- Globalisierung (5)
- Grand coalition (3)
- Green Germany (1)
- Große Koalition (3)
- Grünen (11)
- Günter Grass (1)
- Günter Wallraff (2)
- Hamburg (2)
- Haushaltsdebatte 2008 (7)
- Health reform (1)
- Hirsi Ali (1)
- Holiday at home (1)
- IFA (1)
- Illegal migration (1)
- Iron Cross (1)
- IT (1)
- Joschka Fischer (3)
- Jugendgewalt (2)
- Karl Valentin (1)
- Kinder und Eltern (5)
- Konkret (1)
- Kultur (1)
- Kunst (1)
- Kurt Beck (6)
- Landtagswahlen 2008 (4)
- Leipzig (1)
- Liechtenstein-Affäre (1)
- Linkspartei (2)
- Marx (1)
- Medien (4)
- Merkel (29)
- Merkels Besuch in Israel (3)
- Merrill Lynch (1)
- Mindestlohn (13)
- Mittelstand (1)
- Mode (1)
- Nokia-Werksschließung (9)
- Numico (1)
- Öko-Industrie (1)
- Orange (1)
- Pflegebeitrag (1)
- Politische Linke (1)
- Porsche (10)
- Potsdam (1)
- Projekt Gutenberg-DE (1)
- Punk (1)
- Recession (2)
- Red (1)
- Regulations (1)
- Rente mit 67 (1)
- Romantik (1)
- Rot-rot-grüne Koalition (1)
- Rote Armee Fraktion (24)
- SAG (1)
- SAP (3)
- Schule (4)
- Schwarz-Grün (1)
- Seedcamp (1)
- Siemens (23)
- Simone de Beauvoir (1)
- small and medium-sized -concerns (1)
- Software AG (2)
- Solar Valley (1)
- Sozialdemokratie (2)
- SPD (19)
- SPD Kurswechsel (4)
- SPD-Bundesparteitag in Hamburg (12)
- Stefan George (1)
- Steuerreform (3)
- Steuerskandal (1)
- Strategie Trends (1)
- The Left Party (1)
- The Weimar Republic (2)
- Threat of terrorist attacks (1)
- TNT (1)
- Tokio Hotel (1)
- Trends (2)
- U2 (1)
- Unternehmen (11)
- Verhältnis zwischen Deutschland und Amerika (1)
- Volkswagen (11)
- Wirtschaftspolitik (1)
- Wolf Biermann (1)
- Zumwinkel (3)
Blog Archive
-
▼
2008
(59)
-
▼
March
(18)
- Mindestlöhne: Entscheidungsschlacht in der Koaliti...
- SPD: Michael Naumann über die Krise der Partei | Z...
- FT.com / Home UK / UK - Not everyone is happy in e...
- FTD.de - International - Nachrichten - Jubel für d...
- Germany and Israel | Friends in high places | Econ...
- Der Kommentar - Politik - FAZ.NET - Merkels Besuch...
- Bono forciert Zusammenarbeit mit Adidas Entwicklun...
- Investoren aus Schwellenländern Entwicklungshilfe ...
- Joschka Fischer: Zurück in die Zeiten des Selbstbe...
- Antikapitalist mit Weitsicht | Wirtschaft | Deutsc...
- FT.com / Home UK / UK - SPD leader defends party m...
- FT.com / Home UK / UK - Beck defends leftward shift
- Cebit 2008 - Computer & Technik - FAZ.NET - Fazit ...
- Porsche and VW | In the driving seat | Economist.com
- German Registration Process Offers Few Savings for...
- Cebit 2008 sueddeutsche.de
- Strategiewechsel der SPD Ein Fundament der Lüge - ...
- FTD.de - IT+Telekommunikation - Nachrichten - Die ...
-
▼
March
(18)
About Me
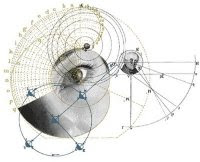
- Albert van Grondelle
- Informatieprofessional gespecialiseerd in het organiseren van content, kennis en samenwerking(collaboration) in de onderneming.


No comments:
Post a Comment