Die geplante Zusatzprämie in der Krankenversicherung muss aus Steuermitteln bezahlt werden, verlangt Ökonom Jürgen Wasem. Der derzeitige Streit über die Höhe sei sinnlos.
Von Cerstin Gammelin
Der Krach um die so genannte Überforderungsklausel blockiert gegenwärtig die Verhandlungen der Großen Koalition über die Gesundheitsreform. Konkret geht es dabei um die Höhe der Zusatzprämie, die die Versicherten künftig entrichten müssen, wenn ihre Kasse mit dem Geld, das sie aus dem neuen Gesundheitsfonds erhält, nicht auskommt. Die SPD will diesen Beitrag auf ein Prozent des Haushaltseinkommens begrenzen. Die Union lehnt das ab, da sie befürchtet, dass es auf diese Weise noch weniger Wettbewerb zwischen den Kassen geben könnte, als das schon heute der Fall ist.
Nun hat die SPD zwar die so genannten Eckpunkte auf ihrer Seite, denen die Union im Juli zugestimmt hat, und die eine entsprechende Begrenzung beinhalten. Doch das stört die Konservativen wenig. Sie wollen die Vereinbarung rückgängig machen. Mindestens zwei oder drei Prozent des Einkommens müssten die Kassen erheben dürfen, damit Wettbewerb entstehe, fordert zum Beispiel Thüringens Ministerpräsident Dieter Althaus.
Dem widerspricht der Essener Gesundheitsprofessor Jürgen Wasem, der Anfang des Jahres ein Fondsmodell mitentwickelt hat, jedoch in der Zwischenzeit skeptisch geworden ist. Entscheidend für den Erfolg der Zusatzprämie sei keinesfalls, auf welche Höhe man sich einigt, sagte Wasem ZEIT online. Entscheidend sei vielmehr, wer den Zusatzbeitrag bezahlen müsse.
Wenn dies – wie bisher geplant – die Versicherten seien, werde die Zusatzprämie zum Bankrott zahlreicher Kassen führen, befürchtet Wasem. Der zusätzliche Betrag werde eine Massenflucht der Gesunden und Gutverdiener in Gesellschaften ohne Kopfprämie auslösen, argumentiert der Wissenschaftler. Zurück in der defizitären Kasse blieben nur Alte, chronisch Kranke oder Arbeitslose – die Härtefälle eben. Der finanzielle Ruin der betroffenen Kassen sei die logische Folge. Diesen Effekt, wundert sich Wasem, müssten die Gesundheitsexperten beider Parteien kennen.
Qualitätswettbewerb zwischen Kassen, Ärzten und Kliniken könne die Zusatzprämie dagegen bewirken, wenn das zusätzlich benötigte Geld entweder aus dem Fonds selbst oder aus Steuermitteln fließe. „Die Subvention der Geringverdiener muss sozialisiert werden“, fordert Wasem.
Doch von einer so einschneidenden Änderung ihres bisherigen Konzept sind die Experten beider Seiten weit entfernt. Denn auch die Reform des Risikostrukturausgleiches, der eine Voraussetzung für die Einführung des Fonds darstellt, ist ebenfalls noch lange nicht unter Dach und Fach.
TEIL 2
Die Schwierigkeit besteht dabei darin, dass die Bundesländer unterschiedlich stark von einem vollständigen Finanzausgleich betroffen sind. Die zusätzliche Einführung des Ausgleichs von Krankheitsrisiken hätte im Vergleich zum heutigen Risikostrukturausgleich „gravierende Umverteilungseffekte“ zur Folge, schreibt Uwe Repschläger in einem internen Gutachten. Beispielsweise hätte das Bundesland Baden-Württemberg – das Land mit den höchsten Einkommen in Deutschland – bei einem vollständigen Finanzausgleich zwei Prozent weniger Geld für Krankenhäuser übrig.
Das Land müsste das Budget für Ärzte um sechs Prozent kürzen, insgesamt 13 Prozent der Grundlohnsumme der Versicherten in den bundesweiten Finanzausgleich zahlen und hätte 301 Euro je Versichertem und Jahr weniger zur Verfügung. Gewinner der geplanten Umstellung und der sich daraus ergebenden Vergütungen für niedergelassene Ärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser und andere Leistungserbringer wären die Regionen im Osten sowie Hamburg und das Saarland.
Viel Zeit bleibt der Großen Koalition nicht mehr, um derlei Interessengegensätze aufzulösen. Schon am vierten Oktober wollen sich die Spitzenvertreter im Kanzleramt treffen, um die Konflikte beizulegen. Auch am heutigen Donnerstag tagt erneut eine Expertenrunde. Ob diese über den mittlerweile vorliegenden dritten Entwurf des Gesetzes abschließend beraten kann, ist aber noch unklar. Die Unionsbundesländer wollten nämlich eigene Formulierungshilfen vorlegen. Diese waren allerdings bis Mittwochabend noch nicht fertig.
Wie aus einem neuen Gesetzentwurf hervorgeht, könnte sich zudem die Verschiebung des Gesetzes negativ auf die Reform auswirken. Da das Gesetz wegen der Streitigkeiten erst zum 1. April 2007 und nicht wie ursprünglich geplant zum 1. Januar in Kraft treten wird, würden die Einsparungen durch die Reform um Hunderte Millionen geringer ausfallen, berichteten mehrere Zeitungen.
Statt 1,9 Milliarden Euro würden nur noch 1,3 Milliarden eingespart. Der Sprecher des Gesundheitsministeriums Klaus Vater sagte allerdings: »Darauf würde ich nicht wetten.« Die zuletzt positive Lohnentwicklung sowie weitere Zuweisungen verbesserten die Einnahmen der gesetzlichen Krankenkassen.
Zudem wirke das Arzneimittel-Spargesetz vom Frühjahr besser als geplant. Die Arzneimittelausgaben waren von Januar bis Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur rund halb so stark gestiegen wie im ersten Quartal. Durch die Reformverschiebung gewönnen die Kassen auch mehr Zeit, die Reform vorzubereiten und so »die im vorgesehenen Gesetz liegenden Möglichkeiten der effizienten Verwendung von Beitragsmitteln durch neue Verträge von vornherein besser zu nutzen«, sagte Vater. Die Gesamtausgaben der Kassen liegen bei rund 145 Milliarden Euro pro Jahr.
© ZEIT online
skip to main |
skip to sidebar
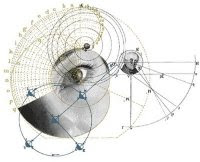
Labels
- ABN Amro (8)
- Adidas (1)
- Ageing population (1)
- Alice Schwarzer (2)
- Alkoholmissbrauch (1)
- Arbeitslosengeld I (4)
- Austria (1)
- Autoindustrie (9)
- Autos (5)
- Bafög (1)
- Bahnstreik (1)
- Betreuungsgeld (3)
- Bono (2)
- CDU (3)
- CeBIT (3)
- CeBIT 2008 (4)
- Chinapolitik (2)
- Christian Social Union (CSU) (1)
- Climate Change (3)
- Danone (1)
- Data (1)
- Deutsche Bahn (18)
- Deutsche Bank (2)
- Deutsche Literatur (1)
- Deutsche Post (3)
- Deutsche Telekom (16)
- Deutschpop (2)
- Die Linke (4)
- die Linkspartei (4)
- Die rot-grünen Jahre (1)
- E-learning (1)
- Employment (1)
- Entsendegesetz (1)
- Erich Kästner (1)
- European Union (19)
- Export model (1)
- Feminismus (2)
- Finanzkrise (1)
- France and Germany (1)
- Frankfurter Buchmesse (1)
- Franz Müntefering (3)
- Frauen (1)
- G8 (27)
- G8-reform (2)
- GDL (1)
- Georg-Büchner-Preis (1)
- German armed forces (1)
- German banks (3)
- German engineering companies (1)
- German history (3)
- German investors in Russia (1)
- German Politics (26)
- German trade unions (1)
- German unemployment (1)
- German unification (1)
- Germany in recession (2)
- Germany's biggest-ever tax-evasion scandal (3)
- Germany’s economic downturn (2)
- Germany’s economic upswing (33)
- Germany's government (1)
- Germany's Landesbanken (1)
- Germany's newest high-technology industries (1)
- Germany's Social Democrats (1)
- Global Terror (1)
- Globalisierung (5)
- Grand coalition (3)
- Green Germany (1)
- Große Koalition (3)
- Grünen (11)
- Günter Grass (1)
- Günter Wallraff (2)
- Hamburg (2)
- Haushaltsdebatte 2008 (7)
- Health reform (1)
- Hirsi Ali (1)
- Holiday at home (1)
- IFA (1)
- Illegal migration (1)
- Iron Cross (1)
- IT (1)
- Joschka Fischer (3)
- Jugendgewalt (2)
- Karl Valentin (1)
- Kinder und Eltern (5)
- Konkret (1)
- Kultur (1)
- Kunst (1)
- Kurt Beck (6)
- Landtagswahlen 2008 (4)
- Leipzig (1)
- Liechtenstein-Affäre (1)
- Linkspartei (2)
- Marx (1)
- Medien (4)
- Merkel (29)
- Merkels Besuch in Israel (3)
- Merrill Lynch (1)
- Mindestlohn (13)
- Mittelstand (1)
- Mode (1)
- Nokia-Werksschließung (9)
- Numico (1)
- Öko-Industrie (1)
- Orange (1)
- Pflegebeitrag (1)
- Politische Linke (1)
- Porsche (10)
- Potsdam (1)
- Projekt Gutenberg-DE (1)
- Punk (1)
- Recession (2)
- Red (1)
- Regulations (1)
- Rente mit 67 (1)
- Romantik (1)
- Rot-rot-grüne Koalition (1)
- Rote Armee Fraktion (24)
- SAG (1)
- SAP (3)
- Schule (4)
- Schwarz-Grün (1)
- Seedcamp (1)
- Siemens (23)
- Simone de Beauvoir (1)
- small and medium-sized -concerns (1)
- Software AG (2)
- Solar Valley (1)
- Sozialdemokratie (2)
- SPD (19)
- SPD Kurswechsel (4)
- SPD-Bundesparteitag in Hamburg (12)
- Stefan George (1)
- Steuerreform (3)
- Steuerskandal (1)
- Strategie Trends (1)
- The Left Party (1)
- The Weimar Republic (2)
- Threat of terrorist attacks (1)
- TNT (1)
- Tokio Hotel (1)
- Trends (2)
- U2 (1)
- Unternehmen (11)
- Verhältnis zwischen Deutschland und Amerika (1)
- Volkswagen (11)
- Wirtschaftspolitik (1)
- Wolf Biermann (1)
- Zumwinkel (3)
Blog Archive
-
▼
2006
(142)
-
▼
September
(19)
- German retail sales stagnate (FT)
- Merkel verspricht Kassen mehr Steuergeld (FTD)
- „Zusatzprämie sozialisieren“ (Zeit online)
- Merkel drückt sich um Machtwort (FTD)
- Confidence in Germany's economy hits turning point...
- German inflation falls as oil price tumbles (FT)
- Poor but sexy (Economist.com)
- German ZEW index falls again (FT)
- Truck makers prepare for sharp turn (FT)
- Germany shifts from Europe’s engine to brake (FT)
- Enscenering van dampende weelderigheid
- Ein blauer Brief für Angela Merkel (FAZ)
- Merkel ponders Atlantic free trade zone (FT)
- Germany eyes free-trade zone to rival China (FT)
- Germany rejects Barroso energy call (FT)
- Günter Grass liest aus „Beim Häuten der Zwiebel“ (...
- Auch wenn alle mitmachen - ich nicht (FAZ)
- Berlin poised to fall into lineon stability pact (FT)
- Managers will come to miss the voice of the prolet...
-
▼
September
(19)
About Me
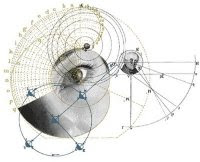
- Albert van Grondelle
- Informatieprofessional gespecialiseerd in het organiseren van content, kennis en samenwerking(collaboration) in de onderneming.


No comments:
Post a Comment